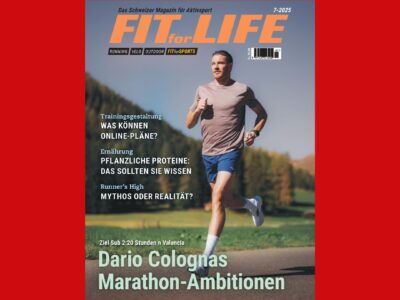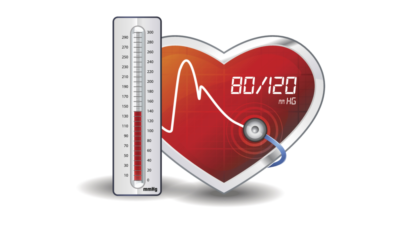Trailrunning, also das Laufen abseits von Strasse und Mainstream, ist aktuell selbst fast zum Mainstream geworden – aber das zurecht. Denn nicht zuletzt dank der Zusatzportion «Natur» macht das Laufen offroad enorm Spass. Den richtigen Schuh zu finden, ist allerdings gar nicht so einfach – das gilt es zu beachten.
Strasse oder Trail? Der Unterschied bezüglich Anforderung ist schnell erklärt: Während beim Strassenlauf der Fuss auf einem flachen und asphaltierten Boden mehr oder weniger immer gleich und vor allem berechenbar aufsetzt, ist der Fuss im Gelände dem unterschiedlichen Untergrund und generell den Elementen weit stärker ausgesetzt als auf der Strasse.
Dies äussert sich in einer riesigen Bandbreite an möglichen Trailrunning-Situationen. Gut möglich, dass nur schon während eines einzelnen Trailruns unterschiedlichste Anforderungen an einen Schuh gestellt werden – vom Anlaufen auf Teer und Kies über moosigen oder allenfalls rutschigen Untergrund oder einen Wurzeltrail im Wald bis hin zum hochalpinen Bergweg mit einzelnen spitzen Steinen oder über ganze Geröllfelder hinweg.
Es liegt daher auf der Hand, dass ein guter Trailschuh meist der bestmögliche Kompromiss ist für unterschiedliche Situationen. Deswegen haben engagierte Trailrunner oft mehrere Modelle in Ihrem Laufschuhschrank, um für alle Bedingungen gewappnet zu sein. So leistet der leichtgewichtige Wettkampf-Finken bei einem trockenen und nicht zu langen Berglauf auf hartem Untergrund zwar beste Dienste, im Dauereinsatz durch ein feuchtes Moorgebiet oder über spitze Steine ist er aber hoffnungslos überfordert. Geht’s auf dem Trailrun lange und viel bergab, wird eine gute Dämpfung vermehrt zum Thema und auf losem und steinigem Untergrund ist ein perfekter Fersenhalt das wichtigste Kriterium, um nicht umzuknicken. Die passende Trailschuhwahl hängt also enorm vom Einsatzgebiet des Schuhs und den athletischen Fähigkeiten des Läufers oder der Läuferin ab.
Kommt dann noch dauerhaft schlechtes Wetter dazu, werden die Anforderungen noch spezifischer. Und auch die Distanz – die auch bei vielen Hobbyläufern in den letzten Jahren immer länger geworden ist – verändert die Bedürfnisse an das passende Modell. Je mehr Kilometer und je grösser die Anzahl Abwärtsmeter, desto wichtiger wird der Komfort und es kommen vermehrt gut dämpfende Schuhe ins Spiel.
Die Qual der Wahl
Laufgenuss pur in all seinen Facetten vermittelt offroad erst die richtige Schuhwahl. Doch wie kann man anhand der zahllosen möglichen Trail-Situationen sinnvolle Tipps geben, welche Art Schuhe oder gar welche konkreten Modelle zu einer Trailläuferin oder einem Trailläufer passen?
Wir haben bei Brigitte Gerber nachgefragt, einer seit vielen Jahren begeisterten Trailrunnerin, die neben vielen kleineren Läufen auch Ultraläufe wie den Eiger Ultra über 250 km oder den Trail Verbier über 110 km gemeistert hat. Die 59-Jährige ist aber nicht nur selbst langjährige Trailrunnerin, sondern hat seit vielen Jahren ihr Hobby zum Beruf gemacht. Im Laufsport-Fachgeschäft 4feet in Bern empfiehlt Sie aus einem riesigen Sortiment den Kundinnen und Kundinnen die passenden Modelle.
Damit man sich die Unterschiede der einzelnen Trail-Situationen besser vorstellen kann und weiss, wo welcher Typ Schuhe seine Stärken und Schwächen hat, teilt Brigitte Gerber die Bedürfnisse von Trailrunnern grob in 5 Einsatz-Kategorien ein:
1. Feldwaldwiese
Die meisten Hobbyläufer im Unterland, die regelmässig von zuhause aus unterwegs sind, laufen auf einfachem Untergrund wie er auf Schweizer Feld- und Waldwegen üblich ist. Der Untergrund ist zwar nicht mehr asphaltiert, aber auch nicht speziell schwierig.
Feldwaldwiesen-Schuhe sind Übergangsschuhe von reinen Strassenmodellen zu Trailschuhen, also quasi die «Graveler» unter den Laufschuhen. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Dämpfung und Stabilität des Schuhs sind individuell auf den Träger ausgerichtet, also auf sein Gewicht und seine Leistungsfähigkeit abgestimmt.
- Sinnvoll ist eine profilierte Sohle, die sich leicht «entleert», d. h. die Noppen sind nicht zu viele an der Zahl und nicht zu eng angeordnet. Die Gummimischung ist tendenziell eher weich für einen guten Grip.
- Das Obermaterial ist nicht mehr so extrem auf Komfort ausgerichtet wie das Mesh-Material von reinen Strassenmodellen, sondern etwas robuster gestaltet für besseren Halt und mehr Widerstandsfähigkeit.
Diese Modelle eignen sich für den Feldwaldwiesen-Einsatz:
- Asics Gel Trabucco 13
- New Balance Hierro v9
- Dynafit Trail
2. Singletrails
Wer viel im Wald oder in der Nähe von Flüssen läuft und sich und seine Füsse fordern will, baut gerne Singletrails in die Trainingsrunde ein. Ein wurzeliger Untergrund beansprucht die Fussmuskulatur, ist aber auch sehr gewinnbringend für den gesamten Bewegungsapparat. Singletrail-Schuhe zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Flexible Zwischensohle, damit sich der Fuss dem instabilen und immer wieder andersartigen Untergrund anpassen kann.
- Das Obermaterial sollte den Fuss satt (sockenartig) ummanteln, damit der Fuss nicht im Schuh herumrutscht.
- Tiefes und stollenartiges Sohlenprofil für perfekten Grip.
Diese Modelle eignen sich für den Singletrail-Einsatz:
- Saucony Peregrine 15
- Salomon S/LAB Genesis
- Scott Supertrac RC 3
- Lowa Amplux 2
3. Alpintrails
Für viele ist Trailrunning gleichbedeutend mit dem Laufen in den Bergen und atemraubenden Anstiegen sowie atemberaubenden Aussichten. Dort, wo die Schweizer Waldgrenze aufhört, beginnt der Untergrund aber oft ruppig und teils steinig zu werden und auch steile Abschnitte bergab sind keine Seltenheit. Dadurch wird das Laufen insgesamt technisch schwieriger. Schuhe für Alpintrails zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Die Zwischensohle ist nicht mehr so flexibel, sondern fester für genügend Stabilität und damit die Steine nicht durch die Sohle drücken (allenfalls mit integrierter Rockstopp-Platte).
- Ganz wichtig ist ein perfekter Fersenhalt, wenns geröllig wird.
- Das Obermaterial ist möglichst robust und reissfest konstruiert mit einem verstärkten Schutz vorne bei der Zehenbox.
Diese Modelle eignen sich für den Alpin-Einsatz:
- Hoka Mafate Speed 4
- Altra Lone Peak 9
- Norda 001
- La Sportiva Bushido lll
4. Wettkampf
Im Wettkampf geht es meist um das Optimum zwischen Gewicht und Performance, zumindest bei ambitionierten Läuferinnen und -läufern. Die Charakteristik des Wettkampfs ist dabei ganz entscheidend: Wie lange ist der Lauf, in welchem Gelände findet er statt, wie viele Höhenmeter auf- oder abwärts müssen gemeistert werden?
Beliebte Schweizer Trailevents wie der Aletschlauf oder Jungfrau Marathon sind «schuhtechnisch» einfach zu laufen, bei trockener Witterung können sie sogar in Feldwaldwiesen-Schuhen gelaufen werden und Spitzenläufer sind da manchmal sogar in reinrassigen und möglichst leichten Wettkampffinken unterwegs.
Je länger ein Trail-Wettkampf ist und je mehr Bergabmeter geleistet werden müssen, desto wichtiger wird eine gute Dämpfung des Schuhs, während bei reinen Bergaufläufen die Dämpfung eine untergeordnete Rolle spielt.
Bei den Witterungsverhältnissen zu beachten ist nicht nur die Wettkampfprognose, sondern auch die Bedingungen in den Tagen davor sind entscheidend. Ist das Gelände durch viele Regentage tief und aufgeweicht, matschig und rutschig? Wichtig zudem, dass man sich bereits ausgiebig im Training an ein Schuhmodell gewöhnt hat und keine Überraschungen auftreten, wenn man lange damit unterwegs ist. Diese Modelle eignen sich für den Wettkampf-Einsatz:
Kurze Events, Vertical-Events und technische Läufe:
- Salomon S/LAB Pulsar
- La Sportiva Prodigio Pro
- Nnormal Kjerag
Ultratrails:
- Salomon S/LAB Ultra
- Hoka Speedgoat 6
- Altra Mont Blanc
- Lowa Fortux
5. Wetterfestigkeit
Regen verändert das Trailrunning durch die Veränderung des Untergrunds deutlich massiver als beim Strassenlaufen. Und ein verstärkter Witterungsschutz erfordert eine andere Bauweise der passenden Schuhe.
- Bei tiefen Böden ist eine stark profilierte Sohle mit möglichst hohen Stollen gefragt für guten Halt, bei steinigem Untergrund eher eine flache Sohle mit weicher Gummimischung, damit man nicht auf den Steinen rutscht.
- Ein Schuh mit wasserdichter Membran (Gore-Tex; Sympatex) kann allenfalls bei langen Läufen und im Training Sinn machen, Spitzenläufer laufen allerdings kaum damit, weil eine Membran im Schuh das Obermaterial etwas steifer und auch schwerer macht.
Diese Modelle eignen sich für den Schlechtwetter-Einsatz:
- Asics Gel Trabucco 13 GTX
- Hoka Challenger ATR7 GTX
- La Sportiva Bushido lll GTX
Die wichtigsten Konstruktionsmerkmale von Trailschuhen
- Profil: Die Sohle ist wesentlich grobprofiliger konstruiert als bei normalen Trainingsschuhen für die Strasse. Je nach Anforderung kommen unterschiedlich zahlreiche und auch unterschiedlich grosse Noppen zum Einsatz. Grobe Noppen eignen sich im Schlamm und durch nasse Wiesen, sind aber auf Steinen rasch überfordert. Oft wird das Sohlenprofil in eine Aufprall- und Abstoss- sowie Abrollzone mit unterschiedlichen Gummimischungen und Anordnungen unterteilt. Im technischen Gelände kommen eher härtere Gummimischungen zum Einsatz, da sie den Schuh stabiler machen.
- Aussensohle: Ein wesentliches Trailmerkmal ist die grosse Standfläche der Aussensohle, sie ragt seitlich meist deutlich über die Standfläche des Fusses hinaus, welcher dadurch in der Sohle eingebettet wird für einen guten Halt im unwegsamen Gelände. Mit modernen Technologien wie dünnen Rock-Stopp-Platten im Vorfussbereich der Sohle können auch leichte Wettkampfschuhe so gebaut werden, dass spitze Steine nicht durch die Sohle drücken.
- Obermaterial: Das Obermaterial ist robuster konstruiert und daher oft nicht ganz so anschmiegsam wie gewohnte Trainingsschuhe mit Mesh-Materialien. Moderne Technologien sorgen dafür, dass Robustheit und geringes Gewicht gleichzeitig erreicht werden können. Dicht gewobenes Obermaterial oder solches mit Netzeinsätzen verhindert, dass sich der Schuh im ruppigen Gelände verheddert oder durch spitze Steine oder Äste aufgerissen wird. Das Obermaterial von Schuhen mit wasserdichter Membran verhindert das Eindringen von Nässe, ist aber weniger dehnfähig und etwas steifer. Daher die Schuhe vor dem Kauf unbedingt anprobieren und testlaufen.
- Schnürung: Viele Trailrunning-Schuhe haben dünne, feste Schuhbändel, teilweise mit einem Schnellschnürsystem. Diese können auch mit kalten Fingern bedient werden und verhindern, dass sich die Schuhbändel öffnen. Mittlerweile kommen auch das im Radsport beliebte Boa-System oder ähnliche Verschlüsse zum Einsatz. Damit kann der Sitz rasch und stufenlos angepasst werden.
- Stabilität oder Flexibilität? Mittlerweile ist beides möglich. Ein guter und stabiler Halt der Ferse bedingt nicht mehr zwingend eine harte Fersenkappe wie früher. Ein guter Fersenhalt kann auch durch eine Verbreiterung der Aussensohle und eine geringe Sprengung (unterschied Heel to Toe) erreicht werden. Dadurch besteht weniger Gefahr umzuknicken.
- Dämpfung: Auf weichem Untergrund und auf steilen Bergwegen (reine Bergläufe bergauf) werden die Dämpfungselemente wesentlich flacher und kleiner gehalten als bei Strassenschuhen, denn da ist der direkte Bodenkontakt wichtiger als eine gute Dämpfung. Auf langen Strecken hingegen wird die Dämpfung wichtiger.
- Zehenbox: Eine stabile Zehenbox schützt vor schmerzhaften Schlägen auf die Zehen bei Bergabpassagen im Geröll oder bei Wurzelpassagen im Wald
- Knöchelschutz: Im gerölligen Gelände könnte ein Knöchelschutz wie bei einem Trekkingschuh Sinn machen, allerdings schränkt ein solcher meist die Bewegungsfreiheit ein. Daher werde halbhohe Trailrunning-Modelle bis heute nur selten gebraucht. Einige Trailrunner behelfen sich als Kompromiss teilweise mit Schutzbandagen.
Jede Bauweise hat andere Vor- und Nachteile
- Je leichter ein Schuh, desto weniger Stabil- und Schutzelemente sind eingebaut.
- Je grober das Sohlenprofil (Nocken), desto mehr Grip bei Nässe und Schlamm, aber desto unruhiger wird das Laufen auf ganz flachem Untergrund.
- Je feiner das Sohlenprofil, desto mehr Grip auf festem, trockenem Boden, aber rutschiger auf feuchtem Untergrund.
- Je mehr Schutz vor Nässe (Membrane), desto steifer – und meist auch weniger atmungsaktiv – ist das Obermaterial.
- Je dünner die Zwischen- und Aussensohle, desto direkter läuft sich ein Schuh, aber desto stärker sind spitze Steine in der Fusssohle spürbar.
- Je flexibler ein Schuh im Mittelfuss, desto einfacher das Laufen bei steilen Bergauf-Passagen, aber schwieriger im groben Geröll.
- Je geschützter und breiter der Fersen und Zehenbereich, desto sicherer der Einsatz im gerölligen Gelände.
- Je geringer die Sprengung (Unterschied Heel to Toe), desto mehr Stabilität auf losem Untergrund.
- Je flacher die Zwischensohle, desto direkter der Bodenkontakt, aber desto geringer Dämpfung und Komfort bei flachen Verhältnissen (Wald- und Feldwege).
- Je mehr integrierte Schutzfunktionen wie hochgezogene Zehenbox, Stützelemente, strapazierfähiges Aussenmaterial, desto schwerer und klobiger wird ein Schuh.
- Je dichter das Laufgelände (Gestrüpp und Unterholz), desto wichtiger ist ein geschütztes und geschlossenes Schnürsystem.
- Je feiner (sandiger) der Untergrund, desto wichtiger ein geschützter Knöchelabschluss
Passende Grösse: Ein halber Daumen genügt
Früher lautete die Regel, dass bei einem Trailrunningschuh vor dem längsten Zeh eine Daumenbreite Platz sein sollte, damit die Füsse auch auf langen Läufen und bergab nicht vorne anstossen. Durch die moderne Konstruktionsweise des Obermaterials reicht heute ein halber Daumen bzw. etwas weniger Platz ist sogar besser, damit der Schuh richtig sitzt und beim Bergablaufen nicht im Schuh herumrutscht. Blaue Zehennägel kommen selten von zu kurzen Schuhen, sondern eher von zu flachen Zehenboxen, welche dann bei sehr langen Läufen (zu) viel Druck von oben auf die Zehennägel ausüben. Zu grosse Schuhe erhöhen zudem die Stolpergefahr.
Welcher solls denn sein?
Stellen Sie sich diese 3 Fragen!
Damit ein spezialisierter Verkäufer im Fachgeschäft den auf Ihren Laufstil passenden Trailschuh ermitteln kann, sollten Sie sich vor dem Kauf eines Trailrunningschuhs die folgenden drei entscheidenden Fragen stellen:
- Für welches Gelände soll der Schuh passend sein?
- Wie lange sind meine Läufe normalerweise?
- Brauche ich den Schuh fürs Training im Alltag oder für den Wettkampf?