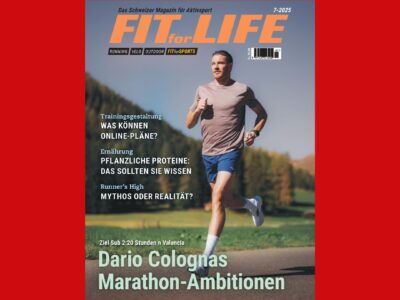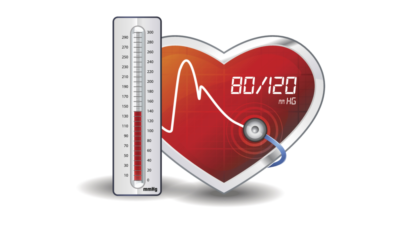Kinder und Jugendliche lassen immer wieder mit enormen Laufleistungen aufhorchen. Nur selten allerdings setzen sich die Talentiertesten auch im Erwachsenenalter durch. In der Schweiz führt der Weg zum Laufchampion über ein polysportives Fundament – mit dem einen oder anderen Abstecher zum Mille Gruyère.
«Guten Tag, mein Kind ist elf Jahre alt und betreibt schon länger Leichtathletik in einem Club.» So beginnt eine Anfrage bei Swiss Athletics mit dem Wunsch nach einem «professionelleren» Trainingsplan. Vor dem Hintergrund, dass der erwähnte Verein kaum Lauftrainings in diesem Alter anbiete, trainiert der Vater seinen Spross seit sechs Jahren selbst. Und das «nicht ohne Erfolg», wie er stolz anmerkt: «Rund 200 Läufe, davon 114 Siege, 160 Podestplätze» sowie Top-Klassierungen beim Schweizer Final des Mille Gruyère, dem Laufnachwuchsprojekt von Swiss Athletics und Le Gruyère AOP.
«Ob man sich beim Mille Gruyère für den Schweizer Final qualifiziert, eine Medaille holt oder sogar den Titel gewinnt, mag für viele junge Lauftalente im Moment das Wichtigste sein, aber wenn man das grosse Ganze betrachtet, ist es eigentlich unerheblich», sagt Michi Rüegg, Cheftrainer Lauf von Swiss Athletics. Das «grosse Ganze» im Auge zu behalten, sei indes nicht Aufgabe des Kindes, «sondern der Eltern, Trainer, Clubs und Verbände». Der wertvollste Tipp, den Rüegg dem besorgten Vater in diesem Fall geben konnte, lautete: «Geduld haben, möglichst abwechslungsreich trainieren und den kurzfristigen Erfolg nicht vor die langfristige Planung stellen.»
Käse macht Dreikäsehochs Beine
In der Schweizer Leichtathletik vereinen die Nachwuchs-Meisterschaften die Besten des Landes erst ab dem U16-Alter. Daher stehen niedrigschwellige Wettkampfangebote wie der Mille Gruyère (600 m / 1000 m), aber auch der UBS Kids Cup (Sprint, Weitsprung, Ballwurf) sowie der Visana Sprint (60 m / 80 m) bei den 7- bis 15-Jährigen hoch im Kurs.
Zum einen vermitteln die Events Spass und Freude am gemeinsamen Bewegungserlebnis. Zum anderen können sich die Ambitionierteren dank Lokalschauscheidungen, Regional- respektive Kantonalfinals und Schweizer Final auf unterschiedlichen Stufen mit sich und Gleichaltrigen messen. Überdies werden die Siegerinnen und Sieger des Mille Gruyère im Folgejahr ins Vorprogramm von Weltklasse Zürich eingeladen. Eine Riesenmotivation – nicht nur wegen des Stücks Käse, das die Teilnehmenden zur Belohnung erhalten.
Der Mille Gruyère macht den laufhungrigen Dreikäsehochs buchstäblich Beine. Er gilt seit über 15 Jahren als Talentschau und Sichtungsgefäss für die Mittel- und Langstrecken. Die nachmaligen Olympiateilnehmer Julien Wanders (10’000 m), Jonas Raess (5000 m), Valentina Rosamilia und Audrey Werro (800 m) sind daraus hervorgegangen, wobei die beiden U20-WM-Silbermegewinnerinnen ihren Bewegungsdrang bis ins U18-Alter noch anderweitig ausgelebt haben, namentlich im Triathlon und Mehrkampf. Werro, unter anderem U20-Weltrekordhalterin über 1000 m, hält bis heute den nationalen U18-Rekord im Fünfkampf.
Champions werden spät(er) gemacht
Mit ihrem interdisziplinären Werdegang sind die U23-Athletinnen bei Weitem keine Einzelfälle. Im Gegenteil: Selbst das norwegische «Laufwunderkind» Jakob Ingebrigtsen bestätigt die Regel, berücksichtigt man dessen vorläuferischen Abstecher auf die Roll- und Langlaufski bis zum zwölften Lebensjahr. Die Wissenschaft spricht hier von «Specific Sampling» und meint damit eine «Vielseitigkeit in der Spezialisierung».
Doch zurück in die Alpenrepublik. «Die Schweizer Sport-Helden sind polysportiv gross geworden», lautet der Titel und zugleich das Ergebnis einer Umfrage, die Christoph Schmid 2021 für graubündenSport durchgeführt und analysiert hat. Ob Dario Cologna (Fussball/Langlauf), Nino Schurter (Judo/Ski alpin/MTB), André Bucher (Jugi/Nationalturnen/Leichtathletik), Anita Weyermann (Ski alpin/Schwimmen/Leichtathletik) oder Laurien Van der Graaff, die nebst Langlauf, Eisschnelllauf und Fussball «jede erdenkliche Sportart mindestens einmal ausprobiert» hat: Mit wenigen Ausnahmen – etwa im Eiskunstlauf, in der Rhythmischen Gymnastik, im Schwimmsport oder Kunstturnen, wo das durchschnittliche Leistungssport-Einstiegsalter unter zehn Jahren liegt – haben alle späteren Champions eine breitangelegte sportliche Ausbildung genossen und sich erst nach der sechsten, teils sogar neunten Klasse ihrer künftigen «Erfolgsdisziplin» verschrieben.
Weyermann und Schurter fuhren Ski
Anita Weyermann, spielerisch ausgebildet in der «Gymnastischen Gesellschaft Bern» (GGB) und mit 20 Jahren schon WM-Dritte über 1500 m, fuhr in ihrer Gymi-Zeit noch JO-Skirennen – übrigens wie Nino Schurter (gegen den späteren Olympia- und Gesamtweltcupsieger Carlo Janka). 800-m-Weltmeister André Bucher wiederum kam über die Jugendriege zur Läuferriege des STV Beromünster, inklusive Trainings im Schwingkeller (!), ehe er unter Jugendtrainer Andy Vögtli und Nationaltrainer Christoph Schmid via 800 m, 1500 m, 5000 m und Langcross-WM (12 km) zum ersten helvetischen Weltmeister in einer Laufdisziplin avancierte.
Spannend: Trotz ihrer raschen internationalen Erfolge im Juniorenalter – Weyermann war zweifache Weltmeisterin über 1500 m und 3000 m, Bucher WM- und EM-Silbermedaillengewinner über 1500 m respektive 800 m – halten die beiden «Jahrhunderttalente» bis heute ausschliesslich Landesrekorde in den U20-, U23- und Erwachsenen-Kategorien, aber nicht darunter. Bucher über 600 m, 800 m und 1000 m; Weyermann über 1500 m, die Meile, 3000 m und 5000 m.
U14-Rekordinhaberinnen und -Rekordinhaber hingegen sucht man mit zwei prominenten Ausnahmen – den Olympia-Vierten Annik Kälin (Mehrkampf) und Angelica Moser (Stabhochsprung) – vergebens unter den Leichtathletik-Medaillengewinnern an Elite-Grossanlässen. «Eine zu frühe und spezifische Ausrichtung von Sportkarrieren hat äusserst geringe Aussichten auf Erfolg», hält Christoph Schmid in seiner Auswertung fest, und folgert daraus: «Die Eltern und Jugendlichen sind angehalten, im Nachwuchsalter möglichst breit und vielseitig Sport zu treiben, stufengerecht und spielerisch zu trainieren.»
Vielfalt schlägt Monotonie
Zu einem ähnlichen Fazit gelangt Catharina Schmid-Strähl in ihre Untersuchung «Sportliche Nachhaltigkeit von Schweizer Meistertiteln in den U16- und 18-Kategorien sowie Teilnahmen an Nachwuchsgrossanlässen in Bezug auf Spitzensport in der Leichtathletik». Die Swiss-Olympic-Diplomtrainerin Spitzensport und beim LC Therwil Leiterin einer der grössten Leichtathletik-Nachwuchsabteilungen der Schweiz konstatiert, «dass eine frühe und intensivierte Einführung des einseitigen sportartspezifischen Trainings mit den dazugehörigen Wettkämpfen und in Kombination einer stark unterstützten Leistungsentwicklung frühe Erfolge im Nachwuchsalter begünstigen, aber nicht langfristige Erfolge im Aktivalter garantieren.»
Die grössten Chancen auf eine Spitzensportkarriere in der Leichtathletik haben demnach junge Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer. «Je breiter resp. vielseitiger ausgebildet die Gewinner der Schweizer Meistertitel sind, was sich bei multiplen Titeln, insbesondere über die Disziplingruppen hinweg zeigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Athletinnen und Athleten im Spitzensport etablieren.»
Stichproben in der trainingsintensiven, technisch jedoch nicht allzu anspruchsvollen Disziplingruppe Lauf ergaben, dass lediglich 21,3 Prozent der späteren Elite-Performer einen Titel in der U16/U18 gewonnen oder an einem internationalen Grossanlässen bei der U18 oder U20 teilgenommen hatten.
Mit anderen Worten: Die «Dropout-Quote» einstiger Nachwuchs-Champions beträgt im Laufsport knapp 80 Prozent – 93 Prozent im U16- und 78 Prozent in der U18-Altersklasse. Die Ursachen sind vielschichtig. Sie können von simplen Umfeld- und Prioritätenverschiebungen (Studium/Berufsausbildung/Partnerschaft) über mangelnden «Biss» bis zum verfrüht forcierten Training reichen, verbunden mit Leistungsstagnationen, Verletzungen und/oder dem Verlust der Eigenmotivation.
Wille und Leidenschaft entscheiden
In der Übergangsphase vom Nachwuchs- ins Erwachsenenalter werden die körperlichen und mentalen Weichen für eine spätere Spitzensportkarriere gestellt. Das ist die positive Nachricht für alle «Spätzünder». Die sogenannten «Retardierten» schöpfen im Gegensatz zu den «Akzelerierten» ihr Leistungspotenzial «verzögert» aus. Im Idealfall erst auf Elitestufe. Maja Neuenschwander (Marathon), Fabienne Schlumpf (3000 m Steeple / Marathon), Sabine Fischer (1500 m / 5000 m), Christian Belz (3000 m Steeple / 10000 m) oder auch Viktor Röthlin (10000 m / Marathon) zählten in den Jugendjahren nie zu den absoluten Überfliegern. Ihr grösstes «Talent» bestand vielmehr darin, dranzubleiben (Resilienz) und den Laufolymp mit kontinuierlicher Arbeit Stufe für Stufe zu erklimmen.
Laut Wildor Hollmann, dem deutschen Vordenker der Sportmedizin und Mitbegründer der «Trimm-dich-Bewegung», können in der Pubertät Altersunterschiede von über sechs Jahren bestehen. Demgemäss liegt die höchste Streuung im biologischen Alter bei Buben im 13. Lebensjahr (+/- 3,36 Jahre), bei Mädchen im 11. Lebensjahr (+/-3,0 Jahre). Christoph Schmid leitet daraus ab: «Der Wille und die Leidenschaft für den Sport sind letztlich vielfach entscheidender als das sichtbare Talent in Form von aktueller Leistung im Jugendalter, die nicht selten von der persönlichen körperlichen Entwicklung abhängig ist. Es geht deshalb nie allein um Leistung, sondern vor allem um das Potenzial.»
Schwierige Potenzialerkennung
Woran aber macht man ein vielversprechendes Potenzial fest? «Das ist insofern eine der grossen Schwierigkeiten, als es kurzzeitig nicht messbar ist», gibt Schmid zu bedenken. Bei manchen Kaderselektionen und Aufnahmen in Talentschulen würden zwar auch Faktoren wie (mentale) Ausdauer, Wille, Leidenschaft und Umfeld berücksichtigt. Allein, ob jemand den Schritt in den Spitzensport schaffe, sei kaum vorherzusehen. «Hinzu kommt, dass man erst im Laufe der Zeit feststellt, ob jemand die erforderliche Trainings-Load überhaupt verträgt.»
Umso bedeutsamer seien bei der Potenzialerkennung gut geschulte Trainerinnen und Trainer mit dem entsprechenden Auge und Feingespür. «Gerade in jungen Jahren sollte man erlebnis- statt resultatorientiert trainieren und nationale Wettkämpfe wie einen Mille Gruyère nicht priorisieren», rät der international erfahrene Swiss-Olympic-Berufstrainer. Schmid nennt in diesem Zusammenhang unter anderem das Stadtberner Trainerduo Sandra Gasser und Beat Aeschbacher. «Die beiden schaffen es im STB seit Jahren, Potenziale über verschiedene Laufgruppen ausfindig zu machen und langfristig weiterzuentwickeln.»
Weg ist wichtiger als Medaille
«Zu Beginn hat mich nur die Leistung interessiert», offenbart allerdings die frühere Spitzenläuferin und Hallen-Europameisterin Sandra Gasser. Heute aber betrachte sie ihre Coachingfunktion ganzheitlicher, sieht sich als Wegbegleiterin von jungen Athleten wie den U20- und U18-EM-Medaillengewinnern Ramón Wipfli (800 m) und Aarno Liebl (3000 m Steeple).
Aber auch von jenen 80 bis 99 Prozent, die eines Tages sprichwörtlich auf der Strecke bleiben. «Natürlich steht die Leistung in unserer Sportart ab einem gewissen Alter und Niveau an erster Stelle, doch der Weg und die menschliche Entwicklung sind viel wichtiger als die Medaille.» Laufen als Lebensschule. Und davon profitieren letztlich alle Beteiligten.