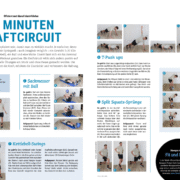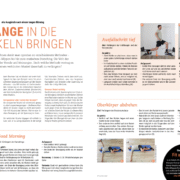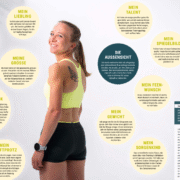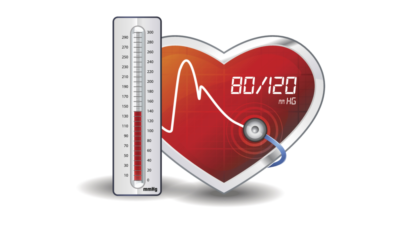Der Begriff «Negative Split» leuchtet nicht auf Anhieb ein, weil er entgegen der Erwartung etwas Positives beschreibt. Einen Negative Split erzielt, wer im Laufsport die zweite Hälfte eines Rennens schneller zurücklegt als die erste. Ein Unterfangen, das leichter tönt als es ist, vor allem für Hobbysportler.
Wer Laufwettkämpfe läuft, begegnet dem Begriff Negative Split meist schon recht früh in seiner Sportkarriere, denn diese Art der Renneinteilung ist so etwas wie der heilige Gral des Laufsports, je länger die Distanz, desto mehr, insbesondere im Marathon.
Wie schwierig das Unterfangen ist, zeigte eine Studie von Jonathan Savage (fellrnr.com), der die öffentlich zugänglichen Resultate von 26 Ausgaben (1998–2012) der grossen Städtemarathons von Chicago und New York analysierte. Savage stellte fest, dass von den knapp 900000 untersuchten Marathonzeiten nur gerade bei 13 Prozent ein Negative Split erreicht wurde.
Warum also soll man sich mit diesem Thema aufhalten, wenn es doch so schwierig umzusetzen ist? Der US-Marathonguru Jeff Daniels beschrieb es in einem «Runner’s World»-Artikel so: «Alle können und sollten einen Negative Split laufen. Doch leider machen das nur die wenigsten. Stattdessen starten sie schnell ins Rennen, hangeln sich durch dessen Mittelteil, ehe sie am Schluss fast ins Ziel kriechen. Im Gegensatz dazu gelingt jenen, die sich im ersten Renndrittel tempomässig etwas zurückhalten und im zweiten Drittel das Tempo langsam erhöhen, ein starker und schneller Schluss.»
Dass die zweite Variante angenehmer und erst noch zielführender ist, leuchtet ein. Die Krux daran: Wer sich das nur für den Wettkampf vornimmt, wird scheitern. Angesichts der kollektiven Euphorie am Start, deren Sogwirkung man sich kaum entziehen kann, läuft man fast automatisch zu schnell los.
Umkehrstrecken als Training
«Sich zu Beginn zurückzuhalten, muss man trainieren», sagt Sportwissenschaftlerin Monika Brand, die schon viele Hobbyläuferinnen und -läufer bei deren Marathonprojekten betreut hat. Ihr wichtigstes Argument für einen behutsamen Start ist, dass man dadurch in der Anfangsphase den körpereigenen Energiespeicher schont, wovon man gegen Rennende profitiert, wo sonst gerne der Hammermann wartet. «Wenn einem dieser begegnet, ist das meist eine Energiesache. Wer etwas langsamer startet, kann die Gefahr eines krassen Leistungsabfalls minimieren», sagt sie.
Wie lässt sich das trainieren? Brand schlägt vor, im Training einen Longrun auf einer Umkehrstrecke zu laufen, sprich die erste Hälfte hin, die zweite zurück, und dabei zu versuchen, den Rückweg ein bis zwei Minuten schneller zurückzulegen. Im Wettkampf rät Brand mit Blick auf den Negative Split, sich einem Pacemaker anzuschliessen, der eine etwas langsamere Zielzeit anpeile als man selber. «Es beflügelt dann enorm, wenn man zum Ende hin am Pacemaker vorbeilaufen kann», sagt sie.
Frauen teilen besser ein
Spannend ist auch Brands Erfahrung bezüglich der Geschlechter: «Frauen fällt es im Wettkampf viel leichter, einen Negative Split zu laufen als Männern. Letztere haben mehr Mühe, unter ihrem Leistungsniveau zu laufen. Frauen können besser einteilen, laufen mehr mit Köpfchen.»
Ein Beispiel dafür ist die Schweizer Marathon-Rekordhalterin Fabienne Schlumpf, der in ihrer Karriere schon mehrere Negative Splits gelangen: Was auch daran liegt, dass sie schon mehrere Marathons im Rahmen internationaler Meisterschaften lief, wo es um Platzierungen und nicht Zeiten geht, weshalb das Ende immer schnell ist. Entsprechend sagt Schlumpfs Partner und Trainer Michi Rüegg, dass bei Meisterschaften ein Negative Split definitiv anstrebenswert sei. «Wenn es aber um eine möglichst gute Zeit geht, ist es am schnellsten, wenn man den Marathon von Anfang bis Schluss so regelmässig wie möglich läuft.» Nur: Um das umzusetzen, muss die Läuferin ihr Leistungsvermögen sehr genau kennen. Sonst läuft sie Gefahr, zu schnell loszulegen und dann einzugehen. Oder zu langsam zu starten und im Ziel zu realisieren, nicht alles herausgeholt zu haben. Soweit die Theorie bei den Profis.
Schöneres Rennerlebnis
Weil es bei den allermeisten Hobbyläuferinnen und -läufern diese Unbekannte bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit gibt, findet Rüegg, bei «ambitionierten Hobbyläufern» mache es durchaus Sinn, wenn diese zum Ende des Marathons hin noch etwas Reserve hätten. Das drängt die Frage auf: Wie definiert Rüegg ambitioniert? «Jede Person, die einen Marathon läuft, ist ambitioniert.»
Einen Negative Split anzupeilen, lohnt sich also allein schon wegen des schöneren Rennerlebnisses, weil man zum Ziel hin noch Energiereserven hat, um zuzulegen – oder zumindest nicht abzubauen. Mit Blick auf die eingangs zitierte Resultatanalyse der US-Städtemarathons muss man aber sagen: Dass diese Taktik für eine persönliche Bestzeit auf jeden Fall die bessere ist, ist alles andere als garantiert. Von jenen Läuferinnen und Läufern, von denen mehr als ein Marathonresultat in die Untersuchung einfloss, führte nur bei 52 Prozent ein Negative Split zur persönlichen Bestzeit – quasi ein Münzwurf. Deutlich erfolgreicher war die Taktik hingegen unter den sehr ambitionierten Läuferinnen und Läufern: Bei jenen mit Bestzeiten unter 2:30 Stunden wurden 69 Prozent aller PBs mit einem Negative Split erzielt.
Kiptum mit extremen Negative Splits
Was mit einem Negative Split alles möglich ist, bewies niemand deutlicher als Weltrekordhalter Kelvin Kiptum: Bei jedem seiner drei Marathons gelang ihm ein geradezu unglaublicher Negative Split. Und 2023 lief er sowohl in London (1:01:40/59:45) wie auch bei seinem Weltrekord in Chicago (1:00:48/59:47) die zweite Streckenhälfte sogar in unter einer Stunde – das war davor noch keinem Marathonläufer gelungen.
Bei Kiptum dürfte noch ein anderer Grund dazu geführt haben, dass er bis zum Halbmarathon vergleichsmässig zurückhaltend lief: Läufer, die fähig sind, den Halbmarathon unter einer Stunde zu laufen, wollen keine Pacemaker sein, sondern selber um Siege laufen. Was für Kiptum mit einem noch schnelleren Start möglich gewesen wäre, bleibt für immer offen: Er verunglückte Anfang 2024, nur 24-jährig, bei einem Autounfall in Kenia. Seine Bestmarke bleibt bestehen, als überdeutliche Erinnerung für den Erfolg des Konzepts Negative Split.
Stichprobe beim Zürich Marathon 2025
Wie schwierig es ist, beim Marathon einen Negative Split zu laufen, zeigt eine Stichprobenerhebung aus der Rangliste des jüngst durchgeführten Zürich Marathon 2025. Wir pickten sowohl bei den Männern wie den Frauen die Sieger/innen und auf die halbe Stunde einen Läufer bzw. eine Läuferin heraus und berechneten, wie schnell sie ihre beiden Marathonhälften liefen.
Das Resultat: Bei den Männern schafften sowohl der Sieger wie auch ein 3-Stunden-Läufer einen Negative Split, bei den Frauen hingegen keine der herausgepickten Läuferinnen. Eine Tendenz zeigte sich deutlich: Schnelle Läuferinnen und Läufer verpassen einen Negative Split meist nur relativ knapp und laufen die zweite Hälfte ähnlich schnell wie die ersten 21,09 km. Je langsamer die Endzeiten aber werden, desto weniger schaffen es die Teilnehmer – und zwar sowohl Frauen wie Männer – ihr Anfangstempo bis zum Schluss durchzuziehen. Oder mit anderen Worten: Schnellere Läuferinnen und Läufer bzw. solche, die mehr oder schon länger trainieren, sind routinierter und können scheinbar besser einschätzen, welches Tempo sie bei einem Marathon bis zum Schluss durchhalten können.