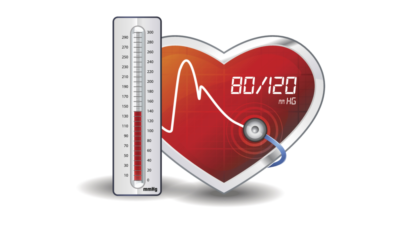Sportwissenschaftler finden immer mehr Gründe, warum man im Wettkampf schneller läuft, fährt oder schwimmt als im Training.
Jeder Ausdauersportler kennt das: Man bereitet sich konsequent und ernsthaft auf einen Wettkampf vor, arbeitet hart an sich selbst und fühlt sich irgendwann in Topform. Auch wenn es vielleicht noch ein paar Wochen bis zum Start sind, steht nun die «Zeit des Zeitenvergleichs» als Standortbestimmung auf dem Programm.
Marathonläufer absolvieren dann gerne eine maximal schnelle 20-Kilometer-Trainingsrunde, Radfahrer stellen sich einem ganz persönlichen Zeitfahren oder einem Berg, der bereits unter Rennbedingungen bewältigt wurde. Und Schwimmer kraulen 1000 bis 1500 Meter mit dem Ziel vor Augen, diesmal schneller als beim Rennen vor einem Monat zu sein.
Beim Vergleich mit den Leistungen im letzten Wettkampf macht sich oft Ernüchterung breit. Die Marathonläufer stellen entgeistert fest, dass sie selbst auf der halben Distanz langsamer pro Kilometer gelaufen sind als beim City-Marathon vor zwei Monaten über die volle Distanz. Die Radfahrer müssen erkennen, dass sie den Berg während des letzten Rennens deutlich schneller bezwungen haben und bei den Schwimmern sind es zwar nur ein paar Sekunden, die den Unterschied ausmachen – aber eben ein paar Sekunden zu viel. Wofür das ganze Training…?
Keine Panik nach Trainingsleistung
Dass Sportler im Training nur sehr selten ihre Wettkampfleistungen abrufen können, ist ein altbekanntes Phänomen. Neu ist allerdings die Erkenntnis, dass vor allem solo trainierende Ausdauersportler deutliche Diskrepanzen zwischen Trainings- und Wettkampfzeiten verzeichnen.
Seit jeher erklären sich Sportler diese Leistungsunterschiede mit Thesen wie «während eines Anlasses ziehen dich die Konkurrenten», «der Rennmodus motiviert Körper und Geist», «Leiden geht nur im Wettkampfmodus» oder «nichts stimuliert mehr als der Zweikampf mit dem Gegner». Vermutungen und Beobachtungen, die sicherlich zutreffend sind, nur erklären sie nicht, warum man im direkten Wettbewerb mit dem Gegner wirklich schneller wird und anscheinend über seine antrainierten Leistungskapazitäten hinaus gelangen kann.
Im Laufe der letzten Jahre haben sich daher Sportwissenschaftler und -psychologen verstärkt mit diesem Phänomen beschäftigt. Dabei wurden zum Beispiel Versuche unternommen, mit Befragungen während des Trainings und nach dem Rennen den teils grossen Unterschieden zwischen Trainings- und Wettkampfzeit auf die Spur zu kommen. Gemeinsamer Nenner dieser Untersuchungen: Man ahnt etwas, kommt der «Lösung» Schritt für Schritt näher, kann es aber noch nicht eindeutig wissenschaftlich untermauern. Aspekte wie «optimal auf den Punkt trainierter Körper» oder «vor dem Rennen besser ausgeruht als vor dem Training» sowie «Training ist zur Leistungssteigerung im Rennen da und nicht umgekehrt» spielen dabei ihre gewichtige Rolle.
Duelle machen schneller
Eine spannende, weil zumindest im Ansatz erklärende Studie* zum Thema veröffentlichte vor einigen Jahren der niederländische Sportwissenschaftler Marco Konings, die er im Laufe des letzten Jahres mit weiteren Versuchen untermauerte.
Konings untersuchte die Auswirkungen von physischer und psychischer Müdigkeit auf ein Duell beziehungsweise auf den Wettbewerb. Der Wahl-Engländer arbeitete dabei mit trainierten und an Rennsituationen gewöhnten Radfahrern, die zwei vier Kilometer lange Strecken mit maximal möglichem Tempo fuhren – einmal alleine und einmal mit virtuellem Gegner.
Wie nicht anders zu erwarten, waren die Fahrten gegen die virtuellen Gegner deutlich schneller als die Fahrten, bei denen die Gümmeler auf sich alleine gestellt waren. So weit, so vorhersehbar. Konings und seine Kollegen von der Uni Essex gingen jedoch einen Schritt respektive eine Pedalumdrehung weiter: Sie nahmen bei jedem Radfahrer vor und nach dem Test eine Kontraktionsprobe der Beinmuskulatur. Mit elektrischer Stimulation konnte so ermittelt werden, wie viel zusätzliche Kraft den Muskeln entzogen wurde.
So wurde die periphere und zentrale Müdigkeit gemessen: Wie viel schwächer ist der Muskel als solcher nach der jeweils absolvierten Strecke und wie viel schwächer ist der Impuls aus dem Gehirn an die Muskeln? Konings und sein Team konnten nachweisen, dass die zentrale Müdigkeit im Gehirn bei der Solofahrt und bei der Fahrt gegen den virtuellen Gegner in ungefähr gleichen Teilen sank (nur 1,5 Prozent Unterschied). Spannend wurde es bei der peripheren, muskulären Müdigkeit: Sie war nach den Zweikämpfen um sieben Prozent höher als bei der Solofahrt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass mehr Leistung abgerufen werden konnte durch den Umstand, dass man sich in einem Duell befand.
Der Jagdinstinkt im Mensch?
Wie ist das möglich? Manche Wissenschaftler verweisen auf eine Art Jagdinstinkt, der noch aus grauen Vorzeiten in uns schlummert und ein ähnliches Muster aufweist wie ein sportlicher Wettkampf. In diesem Zusammenhang werden gerne auch Endorphine «ins Spiel» gebracht, die immer dann für relativ kurze Zeit zum Einsatz kommen, wenn wir unsere Belastungsgrenzen überschreiten.
Diese körpereigenen Schmerzstiller treten meist im Zusammenhang mit Dopamin auf, die für Glücksgefühle zuständig sind. Bildlich gesprochen: Wir rennen oder fahren mit maximaler Leistung gegen einen ungefähr gleich starken Gegner, freuen uns über unsere Performance und setzen dabei Schmerzstiller frei, die wiederum den Körper kurzfristig darüber hinweg täuschen, dass gerade überproportional viel Leistung von ihm abverlangt wird.
Eine andere These beruht auf Tests, die während harter Trainingseinheiten in unterschiedlichen Sportarten durchgeführt wurden. Demnach senden Metaboliten (eine Substanz, die im Stoffwechsel gebildet wird) Signale ans Hirn, die als Schmerz interpretiert werden. Die zumindest theoretisch einfache Lösung: Je länger man diese Schmerzsignale ignorieren kann, desto mehr Leistung wird freigesetzt. Und scheinbar schafft man es einfacher, die Signale zu ignorieren, wenn man einem realen oder virtuellen Gegner hinterherjagt oder selbst gejagt wird.
Wie auch immer man es betrachtet: Sportler sind im Wettbewerb mit anderen, möglichst ähnlich schnellen Konkurrenten offensichtlich rein physiologisch zu mehr Leistung fähig. Was wir im Prinzip schon immer gewusst, zumindest aber geahnt haben, wird nun wissenschaftlich in mehr oder weniger grossen Schritten belegt.
Konsequenz: Mehr Rennsituationen im Training
Da stellt sich die Frage, welchen Nutzen Sportler aus diesen Erkenntnissen ziehen können? Insbesondere Athleten, die viel oder ausschliesslich alleine trainieren, sollten sich bei aller Liebe zur individuellen «Ruhe» im Training regelmässig Wettkampf- bzw. Vergleichseinheiten unter Rennbedingungen mit Sportsfreunden aussetzen. Dies erleichtert durch die vermutlich schnelleren Zeiten die Einschätzung einer reellen «Wettkampfform». Dazu setzen solche Einheiten im Training wichtige Akzente zur Leistungssteigerung.
Wohlgemerkt, es geht dabei nicht um eine gemütliche Gruppenausfahrt, sondern um eine reale Rennsituation. Dabei spielt das Verhalten des Gegners eine elementare Rolle. Denn der beeinflusst durch eine Vielzahl von Faktoren – ähnlich wie im Wettkampf – die Leistung seines Kontrahenten nachhaltig. So kommen Konings und andere Sportwissenschaftler in einer weiterführenden Studie zum Schluss, dass es «für eine zukünftige Erforschung der Wirkung von Gegnern auf die Regulierung der Trainingsintensität» ratsam sei, die Gegner im Zusammenhang mit ihren sozialen Leistungen, Charaktereigenschaften usw. zu verstehen. Gleichzeitig seien persönliche Aspekte des Trainierenden einzubringen – denn es komme eben darauf an, externe Faktoren wie Sportlerverhalten und interne Aspekte wie die erwähnte periphere und zentrale Müdigkeit zu manipulieren.
Wie auch immer: Auf jeden Fall wünschenswert sind Sportduelle mit schnellen Freunden, die einen fordern, einem aber auch verzeihen, falls man schneller ist…
Literatur:
* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26896731